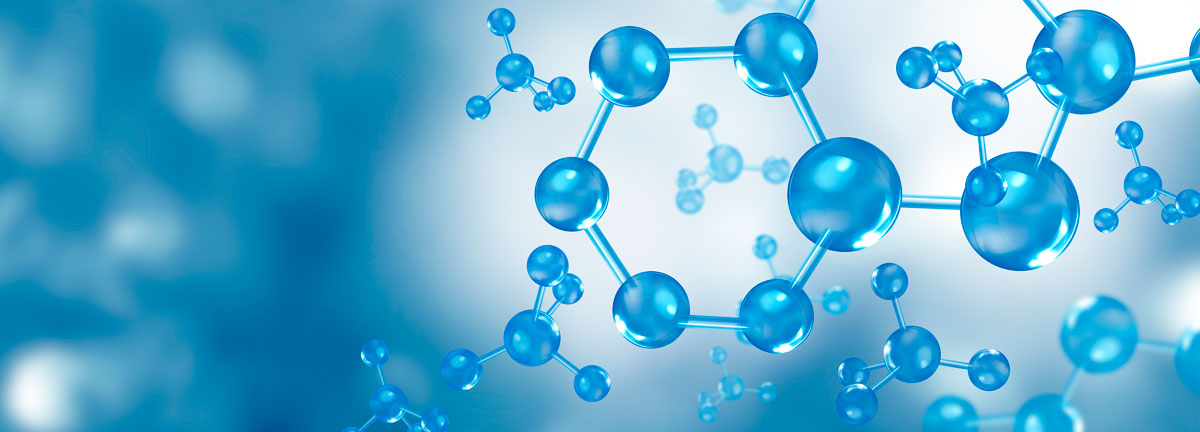Mikroplastik findet sich heute überall: in den Ozeanen und Flüssen, in der Luft, die wir atmen, in Lebensmitteln und sogar in unserem Trinkwasser. Besonders beunruhigend ist, dass viele der winzigen Kunststoffpartikel mit bloßem Auge nicht sichtbar sind und ihr Weg in den menschlichen Körper bis heute zahlreiche Fragen für Umwelt und Gesundheit aufwirft.
Was ist Mikroplastik – und was ist Nanoplastik?
Unter Mikroplastik versteht man feste Kunststoffpartikel, die kleiner als 5 Millimeter sind; noch winziger ist das Nanoplastik, das unter 1 Mikrometer groß ist. Mikroplastikteilchen bestehen meist aus gebräuchlichen Polymeren wie Polyethylenterephthalat (PET), Polypropylen oder Polyester. Die Partikel können unterschiedlich geformt sein (Fasern, Fragmente, Kügelchen) und weisen verschiedene organische und chemische Eigenschaften auf.

Plastik ist in der heutigen Gesellschaft allgegenwärtig. Die zunehmende Produktion wird zum Problem, da so Müll entsteht, der biologisch kaum bis gar nicht abbaubar ist.
Man unterscheidet primäres und sekundäres Mikroplastik:
- Primäres Mikroplastik wird schon absichtlich in kleiner Größe produziert, etwa als Peelingkörper in Kosmetika oder als Granulat zur industriellen Weiterverarbeitung.
- Sekundäres Mikroplastik entsteht, wenn größere Kunststoffteile durch UV-Strahlung, Wärme, Abrieb und andere Umwelteinflüsse in immer kleinere Teilchen zerfallen. Beispiele sind Abrieb von Autoreifen, Fasern aus Waschvorgängen oder sich zersetzende Verpackungen.
Besonders Nanoplastik gibt Anlass zur Sorge: Aufgrund ihrer geringen Größe können diese Partikel biologische Barrieren wie Darm- oder Blut-Hirn-Schranke überwinden und sich langfristig in Organen einlagern. Studien zeigen, dass Nanopartikel sogar in menschlichem Blut, Gewebe und in der Plazenta nachgewiesen werden konnten. Die möglichen Wechselwirkungen und gesundheitlichen Gefahren sind bislang jedoch erst ansatzweise erforscht.
Woher kommt Mikroplastik im Trinkwasser?
Unsere moderne Lebensweise führt dazu, dass Plastik allgegenwärtig ist. Seine Rückstände landen über verschiedene Wege letztlich im Trinkwasser:

Mikroplastik im Ozean ist ein mittlerweile bekanntes Problem.
Quellen
- Industrie und Haushalte: Durch den Einsatz des Mikroplastiks in Kosmetika, Zahnpasta, Reinigungsmitteln, Farben sowie der Kunststoffproduktion gelangen die kleinsten Partikel über das Abwasser in Flüsse und Seen.
- Waschmaschinen & Kleidung: Synthetik-Kleidung verliert bei jedem Waschgang Tausende feine Kunststofffasern, die von Kläranlagen nur unzureichend entfernt werden.
- Reifenabrieb: Beim Fahren auf Straßen lösen sich permanent winzige Gummipartikel, die durch Regenwasser in die Kanalisation und Gewässer gespült werden.
- Zerfall von Plastikmüll in der Umwelt: Weggeworfene Plastikverpackungen, -tüten und -flaschen zersetzen sich langsam durch Sonnenlicht und mechanische Einwirkung, wobei mikroskopisch kleine Plastikteilchen ins Wasser gelangen.
- Landwirtschaft: Plastikfolien und Kunstdünger können Mikro- und Nanoplastik auf Felder und ins Grundwasser eintragen.
Kläranlagen & Wasserversorgung
Kläranlagen sind zwar aufwändig und technisch fortschrittlich, können aber vor allem die kleinstmöglichen Mikroplastikpartikel nicht vollständig aus dem Wasser entfernen. Dadurch gelangt ein beträchtlicher Umfang Mikroplastik in Gewässer, die als Rohstoff für unser Trinkwasser dienen. Aktuelle Studien zeigen, dass sogar abgelegenes Grundwasser nachweislich belastet ist. Durch industrielle Entwicklung, Urbanisierung und den steigenden Verbrauch von Kunststoffen nimmt diese Belastung weltweit weiter zu. Weltweit gelangen jährlich Millionen Tonnen von Mikroplastik in die Umwelt und zwangsläufig auch in den Wasserkreislauf zu den Wasserwerken.
Mikroplastik im Leitungswasser vs. Mineralwasser
Viele Verbraucher gehen davon aus, dass Mineralwasser aus Flaschen sicherer sei als Leitungswasser. Doch zahlreiche Studien beweisen das Gegenteil: Gerade PET-Flaschen enthalten oft vergleichsweise hohe Mengen Mikroplastik, vermutlich aus Abrieb von Flasche, Verschluss und Abfüllprozessen. Glas bietet geringere Risiken, dennoch kann auch in abgefülltem Wasser die Wasserquelle bereits mit Plastikpartikeln belastet sein. In Deutschland gelten zwar strenge Vorgaben und regelmäßige Kontrollen, dennoch ist eine vollständige Filterung technisch bisher nicht möglich.
Wie gefährlich ist Mikroplastik im Körper?
Die Forschung ist noch nicht abschließend, aber folgende Risiken werden diskutiert:
- Physikalische Wirkung: Mikroplastik kann mechanische Reizungen und Entzündungen im Verdauungstrakt oder in Organen hervorrufen. Besonders Nanopartikel sind so klein, dass sie zelluläre Barrieren überwinden und tief im Körper eingelagert werden können.
- Chemische Belastung: Viele Kunststoffe enthalten Weichmacher wie Bisphenol A (BPA) oder Phthalate. Mikroplastik kann zudem Schadstoffe aus der Umwelt (wie Pestizide, Schwermetalle) aufnehmen und im Körper freisetzen, sobald die Teilchen aufgenommen werden.
- Biologische Risiken: Auf den Oberflächen der Partikel können Bakterien wachsen und Biofilme entstehen, die das Wachstum von Keimen in Wasserleitungen begünstigen. Einmal aufgenommen, könnten die Plastikpartikel auch immunologische Reaktionen im Körper auslösen.
Langfristige Studien zu Auswirkungen von Mikroplastik auf die menschliche Gesundheit gibt es jedoch kaum. Die WHO erklärte 2019, dass nach aktuellem Kenntnisstand Mikroplastik im Trinkwasser in geringen Konzentrationen kein akutes Risiko darstelle, betonte aber den mangelnden Wissensstand und forderte weitere Forschung.
Filter und Tests von Mikroplastik im Wasser
Im Privathaushalt ist die Filterung von Mikroplastik möglich, aber von der eingesetzten Technologie abhängig:
- Aktivkohleblockfilter können Kunststoffteilchen – je nach Porengröße – meist bis zu 0,4 µm zuverlässig entfernen und sind für viele Haushalte ausreichend. In Kombination mit einem Membranfilter auch bis 0,15 µm
- Umkehrosmoseanlagen schließen auch noch feinere Partikel, also Teile im Nanoplastik-Bereich, aus. Ihr Nachteil: Sie entziehen dem Wasser auch wertvolle Mineralien, was langfristig zu Einbußen im Geschmack führen kann.
- Tests: Spezielle Wasserproben für Mikroplastik im eigenen Trinkwasser sind für Privatnutzer selten und kostenintensiv. Viele Wasserwerke verfügen selbst noch nicht über standardisierte Messmethoden. Je kleiner die Teilchen, desto schwieriger und teurer sind Nachweis und Entfernung.
Wieviel herausgefiltert werden kann hängt davon ab, wie regelmäßig Filterelemente gewechselt und Anlagen gewartet werden. Im Alltag sind Aktivkohleblockfilter mit feiner Porung ein guter Kompromiss für Haushalte um Mikroplastik aus dem Wasser zu filtern.
Grenzwerte und Regulierung zum Thema Mikroplastik
Die EU-Trinkwasserrichtlinie wurde 2020 angepasst: Neben Limits für bestimmte Weichmacher gibt es erstmals einen politischen Rahmen für den Umgang mit Mikroplastik. Konkrete Grenzwerte werden in den kommenden Jahren noch ausgearbeitet; bislang liegen sie meist aber nur für Industriestoffe vor und unterscheiden sich zwischen den Ländern.
Die größte Herausforderung bleibt die vereinheitlichte Messung und Anerkennung winziger Mikroplastikpartikel – erst darauf können rechtliche Regelungen und flächendeckende Überwachung aufbauen.
Grenzwerte und Regulierung zum Thema Mikroplastik

Für Mikroplastik fehlen Grenzwerte in der Trinkwasserverordnung
Die EU-Trinkwasserrichtlinie wurde 2020 angepasst: Neben Limits für bestimmte Weichmacher gibt es erstmals einen politischen Rahmen für den Umgang mit Mikroplastik. Konkrete Grenzwerte sollen in den kommenden Jahren noch ausgearbeitet werden; bislang liegen sie meist aber nur für Industriestoffe vor und unterscheiden sich zwischen den Ländern.
Die deutsche Trinkwasserverordnung (TrinkwV) wurde erst 2023 novelliert, aber auch hier wurde keine Grenzerte eingeführt!
Die größte Herausforderung bleibt die vereinheitlichte Messung und Anerkennung winziger Mikroplastikpartikel – erst darauf können rechtliche Regelungen und flächendeckende Überwachung aufbauen.
Was können Sie tun? – Praktische Tipps
Auch wenn die Ursachen größtenteils systemisch sind, kann jeder einzelne einen Beitrag gegen Mikroplastik leisten:
- Plastik im Alltag vermeiden: Kaufen Sie möglichst Produkte in Glas, Edelstahl oder anderen langlebigen Materialien. Nutzen Sie Mehrweg statt Einweg, und setzen Sie auf unverpackte Waren.
- Synthetik-Kleidung bewusst waschen: Reduzieren Sie Waschgänge, verwenden Sie spezielle Waschbeutel (z. B. Guppyfriend), vermeiden Sie Wäschetrockner und feuchte Lagerung.
- Kosmetik und Haushaltsmittel prüfen: Viele Alltagsprodukte enthalten nach wie vor Mikroplastik – informieren Sie sich mit Apps wie CodeCheck.
- Trinkwasser filtern: Aktivkohlefilter können die gängigen Belastungen im Trinkwasser erheblich senken; achten Sie auf regelmäßigen Austausch und Reinigung.
- Richtige Mülltrennung & Entsorgung: Sortieren Sie Haushaltsabfälle sorgfältig. Lassen Sie Müll nicht in der Natur zurück – so verhindern Sie, dass Plastik überhaupt in die Umwelt gelangt.
Häufige Fragen und Antworten
Die Belastung ist im internationalen Vergleich niedrig, aber eindeutig messbar. Moderne Wasserwerke entfernen einen Großteil, doch ein vollständiger Schutz ist nicht gewährleistet.
Glas gibt kein Kunststoff ab – das ist ein Vorteil. Allerdings kann das Wasser schon bei der Quelle belastet sein.
Aktivkohleblockfilter sind für Plastikpartikel zwischen 0,1 und 5 Mikrometer sehr effektiv. Feinere Filteranlagen, etwa Umkehrosmose, gehen noch weiter, sind aber aufwändiger in Betrieb und Wartung.
Tests auf Mikroplastikbelastung sind teuer und bislang kaum für Privatpersonen verfügbar. Der Nachweis kleinster Partikel ist technisch aufwendig.
Die EU und viele Staaten haben inzwischen Beschränkungen für den Einsatz von Einwegplastik, Mikroplastik in Kosmetik und verbessern Filtertechniken in Klärwerken. Das Problem ist jedoch nicht kurzfristig lösbar und wird weiterhin intensiv erforscht.
- Hanns Moshammer, Deutschlandfunk (2019) - Mikroplastik im Trinkwasser
- Umweltbundesamt (2025) - Mikroplastik und Trinkwasserqualität
- Umweltbundesamt (2016) - Mikroplastik in Kosmetika – Was ist das?
- Bundesinstitut für Risikobewertung (2024) - Mikroplastik: Fakten, Forschung und offene Fragen
- Foodwatch.org (2019) - Weltgesundheitsorganisation: Risiken von Mikroplastik noch nicht genug erforscht
- Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (2018) - Untersuchung von Mikroplastik in Lebensmitteln und Kosmetika